Die Verpflichtungsklage im öffentlichen Recht – wie prüft man Zulässigkeit und Begründetheit?
04.12.2024 | von Florian Bieker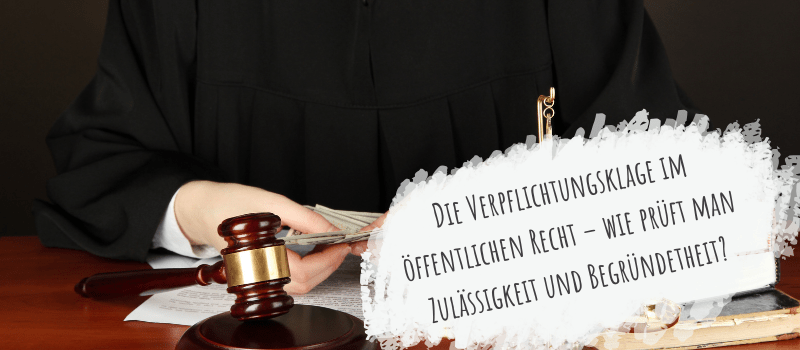
Die Verpflichtungsklage ist eine der Klagen aus dem Verwaltungsrecht AT, welche zum Pflichtfachstoff gehört und daher jedem Studenten und Referendar geläufig sein muss. Diese Klage lässt sich mannigfaltigen Konstellationen in der Klausur integrieren und gliedert sich regelmäßig in Zulässigkeit und Begründetheit, es sei denn die Fallfrage oder der Bearbeitervermerk schließt jeweils die Zulässigkeit oder Begründetheit aus. Da dies regelmäßig jedoch nicht der Fall ist, wollen für Dich einen näheren Blick auf die Zulässigkeit und Begründetheit der Verpflichtungsklage werfen. Wird eine Verpflichtungsklage in der Klausur abgefragt, so erwartet der Prüfer, dass alle erforderlichen Prüfungspunkte geprüft werden. Die Klage ähnelt sich in der Zulässigkeitsprüfung mit der Anfechtungsklage, sodass hier nicht viel Neues gelernt werden muss und die zu prüfenden Punkten auch bei der Verpflichtungsklage „abzuklappern“ sind. Im Rahmen einiger Prüfungspunkte erfolgt allerdings eine andere Prüfung, worauf der Beitrag ebenfalls eingeht, sodass eine Lektüre von diesem Beitrag empfehlenswert ist.
Die Bedeutung der Verpflichtungsklage für die Klausur
Jeder Examenskandidat muss die Verpflichtungsklage sicher beherrschen. Handelt es sich in der vorliegenden Klausur um eine Klausur, wo die Verpflichtungsklage abgeprüft wird, darf man nicht darüber nachdenken, wie die Verpflichtungsklage zu prüfen ist. Der Aufbau muss abrufbereit im Gedächtnis sein, damit ausreichend Zeit für die Bearbeitung der eigentlichen Probleme der Klausur zur Verfügung steht. Ihre Kenntnis ist elementar, um im Examen auch unbekannte Sachverhalte in den Griff zu bekommen und bei den entsprechenden Prüfungspunkten den Sachverhalt ordentlich subsumieren zu können.Im heutigen Blogbeitrag wollen wir Euch daher den Aufbau und die einzelnen Prüfungspunkte der Verpflichtungsklage näherbringen.
Die Zulässigkeit und Begründetheit der Verpflichtungsklage
- Zulässigkeit
1. Eröffnung des Verwaltungsrechtsweg § 40 I 1 VwGO
Die Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges richtet sich bei Fehlen einer aufdrängenden Sonderzuweisung nach § 40 I 1 VwGO. Aufdrängende Sonderzuweisungen sind beispielsweise § 54 I BeamtStG oder § 126 I BBG. Der Verwaltungsrechtsweg ist in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art gegeben, soweit die Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen sind, § 40 I 1 VwGO. Öffentlich-rechtlich ist eine Streitigkeit dann, wenn das Rechtsverhältnis, aus dem sich der Klageanspruch ableitet, öffentlich-rechtlich ist. Zur Ermittlung, ob eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegt, werden dem Grunde nach fünf Theorien vertreten, die nicht alle in einer Klausur dargestellt werden müssen, sondern die jeweils passende Theorie herangezogen werden kann.Zum einen ist die modifizierte Subjektstheorie in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Demnach handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit, wenn sich die streitentscheidenden Normen ausschließlich an einen Hoheitsträger richten und diesen in seiner Eigenschaft als Hoheitsträger berechtigen und verpflichten, wie beispielsweise die §§ 48, 49 VwVfG.
Außerdem wird die sog. Subordinationstheorie vertreten, die besagt, dass eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit dann vorliegt, wenn ein Über – und Unterordnungsverhältnis besteht, wie insbesondere bei dem Begehren oder Erlass eines Verwaltungsaktes.
Eine weitere Theorie, die in diesem Zusammenhang vertreten wird, ist die sog. Kehrseitentheorie, welche besagt, dass die Maßnahme die gleiche Rechtsnatur hat, wie die zu rückgängig machende Maßnahme (sog. Kehrseitentheorie).
Außerdem wird die Ansicht vertreten, dass eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit dann vorliegt, wenn ein eindeutiger Sachzusammenhang mit einem öffentlich-rechtlichen Aufgabenbereich besteht, was unter anderem dann der Fall ist, wenn sich z.B. ein Bürgermeister öffentlich über gewisse Parteien oder Kollegen äußert oder eine Geruchsbelästigung durch eine städtische Kläranlage vorliegt (Sachzusammenhangstheorie).
Zuletzt wird noch die sog. Zweistufentheorie im Rahmen der Leistungsverwaltung vertreten, die besagt, dass zwischen dem „Ob“ und dem „Wie“ zu differenzieren ist. Auf der Stufe des „Wie“ kann es sich sowohl um eine privatrechtliche als auch eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handeln. Handelt es sich jedoch um eine Streitigkeit, die das „Ob“ der Leistungsgewährung betrifft, so handelt es sich stets um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit, wie beispielsweise dann, wenn es um die Frage geht, ob eine Subvention gewährt werden muss.
In einem weiteren Schritt ist dann zu klären, ob die öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art ist. Eine Streitigkeit ist dann verfassungsrechtlicher Art, wenn Staatsverfassungsorgane über Verfassungsrecht im formellen Sinne streiten. Bei diesem Prüfungspunkt handelt es sich selten um einen problematischen Prüfungspunkt, sodass man sich hier kurz halten kann.
Zuallerletzt ist dann noch zu prüfen, ob eine abdrängende Sonderzuweisung vorliegt. Hier ist beispielsweise an § 40 II 1 VwGO oder besonders im Polizeirecht an die §§ 23 ff. EGGVG zu denken und diese auch unbedingt dann anzusprechen, welche jedoch nur dann greifen, wenn es sich um eine repressive Maßnahme handelt. Bei präventiven Maßnahmen ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.
Ergibt sich nach der Prüfung, dass es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art handelt, wo nicht ein anderer Rechtsweg gegeben ist, so ist der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 I 1 VwGO eröffnet. Wichtig zu wissen ist noch, dass eine bei einem falschen Gericht erhobene Klage nicht zur Unzulässigkeit der Klage führt, sondern die Klage gemäß § 83 VwGO i.V.m. §§ 17a I,II 1, 17b I 2 GVG an das richtige Gericht verwiesen wird.
2. statthafte Klageart § 88 VwGO
Die statthafte Klageart richtet sich nach dem Klagebegehren, § 88 VwGO. Bei einer Verpflichtungsklage nach § 42 I Alt. 2 VwGO begehrt der Kläger einen Verwaltungsakt i.S.d. § 35 S.1 VwVfG, wie beispielsweise eine Baugenehmigung, welcher sich noch nicht nach § 43 II VwVfG erledigt hat. Ergeben sich im Rahmen der (gedanklichen) Prüfung keine Probleme bei den Voraussetzungen des Verwaltungsakts nach § 35 S.1 VwVfG, so hat man sich hier kurz zu halten und nur festzustellen, dass es sich bei dem entsprechenden Verwaltungsakt um einen Verwaltungsakt i.S.d. § 35 S.1 VwVfG handelt. Ist dies nicht der Fall, so hat man an entsprechender Stelle bzw. bei entsprechendem Prüfungspunkt zu problematisieren und ggf. zu diskutieren. Ein Verwaltungsakt nach § 35 S.1 VwVfG ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. Besonders beliebt und problematisch sind hier die Merkmale Regelung und Außenwirkung. Die Voraussetzungen werden in einem anderen Blogbeitrag näher beleuchtet. Bei der Verpflichtungsklage ist darüber hinaus auch zwischen zwei Konstellationen zu differenzieren. Zum einen zwischen der sog. Versagungsgegenklage und der Untätigkeitsklage. Bei der Versagungsgegenklage begehrt der Kläger einen bereits abgelehnten Verwaltungsakt. Bei der sog. Untätigkeitsklage ist die Behörde untätig geblieben und hat keinerlei Maßnahmen ergriffen. Oftmals ist erste Konstellation einschlägig, jedoch sollte man wissen, dass auch letztere Situation durchaus mal abgefragt werden kann. Begehrt der Kläger gleichzeitig mit der Aufhebung eines Verwaltungsakts auch den Erlass eines Verwaltungsakts, so ist insgesamt die Verpflichtungsklage die statthafte Klageart, weil diese rechtsschutzintensiver ist und inzident auch über die Aufhebung des negativen Bescheids mit entschieden wird.3. Vorverfahren §§ 68 ff. VwGO
Weiterhin muss ein Vorverfahren erfolglos durchgeführt worden sein. Der Zweck des Vorverfahrens besteht darin, dass die Gerichte entlastet werden, dem Rechtsschutz des Bürgers Genüge getan wird und die Selbstkontrolle der Verwaltung ermöglicht wird. Gem. § 68 I 1, II VwGO ist vor Erhebung einer Anfechtungsklage ein solches Vorverfahren grundsätzlich durchzuführen. Ausnahmen sind in § 68 I 2, II VwGO und im jeweiligen Landesrecht vorgesehen. Bei der Untätigkeitsklage ist der § 75 VwGO zu beachten.4. Klagebefugnis § 42 II VwGO
Die Klagebefugnis richtet sich nach § 42 II VwGO. Demnach ist der Kläger klagebefugt, wenn nach seinen substanziierten Behauptungen die Möglichkeit besteht, dass er in seinen subjektiv-öffentlichen Rechten möglicherweise verletzt ist (sog. Möglichkeitstheorie). Bei der Verpflichtungsklage ist die Adressatentheorie niemals heranzuziehen, weil der Kläger hier im Gegensatz zur Anfechtungsklage nicht Adressat eines belastenden Verwaltungsakts ist. Stattdessen ist auf die sog. Schutznormtheorie abzustellen. Die Schutznormtheorie besagt, dass der Kläger dann klagebefugt ist, wenn die entsprechende Vorschrift dem Schutz eines abgrenzbaren Personenkreises und Individualinteressen dient und der Kläger zu dem geschützten Personenkreis zählt. Es genügt, dass die Möglichkeit besteht, dass der Kläger einen Anspruch auf den begehrten Verwaltungsakt hat. Ob dies tatsächlich der Fall ist, ist eine Frage der Begründetheit.5. Richtiger Klagegegner § 78 I Nr. 1 VwGO
Der richtige Klagegegner ist nach dem sog. Rechtsträgerprinzip gemäß § 78 I Nr. 1 VwGO zu ermitteln.6. Klagefrist § 74 I, II VwGO
Die Klagefrist bei der Versagungsgegenklage richtet sich nach § 74 I 1, II VwGO. Demnach ist die Klage innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids zu erheben. Ist ein Widerspruchsbescheid nach § 68 VwGO nicht erforderlich, so ist die Klage binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zu erheben, § 74 I 2 VwGO. Im Falle der Untätigkeitsklage greift § 75 VwGO. Hier gibt es keine Klagefrist, sondern allenfalls Verwirkung.7. Beteiligungs – und Prozessfähigkeit §§ 61, 62 VwGO
Die Beteiligungs – und Prozessfähigkeit richtet sich nach den §§ 61, 62 VwGO. Hier ist Gesetzesarbeit gefragt und Kläger und Beklagter jeweils unter die passende Vorschrift zu subsumieren.8. Form §§ 81, 82 VwGO
Die Form der Klage ist in §§ 81, 82 VwGO geregelt. Gemäß § 81 I 1 VwGO ist die Klage schriftlich bei dem Gericht zu erheben.9. Zwischenergebnis
Ergibt sich bei einer Prüfung dieser Punkte, dass die Voraussetzungen alle vorliegen, so ist die Klage im Ergebnis zulässig.- Begründetheit
Fazit zur Verpflichtungsklage
Die herausragende Bedeutung der Verpflichtungsklage sollte jedem Studenten und Referendar bewusst sein.Die solide Kenntnis des Aufbaus und der gängigen Probleme sollte vorhanden sein, bevor man eine Klausur im öffentlichen Recht antritt. Besonders Fehler im Rahmen der Zulässigkeit müssen vermieden werden, da diese schwer ins Gewicht fallen.
Solltet Ihr Euch im Verwaltungsrecht AT noch nicht examensreif fühlen, vereinbart gerne einen kostenlosen Probetermin. Unsere erfahrenen Dozenten der Kraatz Group, Akademie Kraatz und der Assessor Akademie stehen Euch vom Grundstudium bis zum 2. Staatsexamen mit Rat und Tat zur Seite.
Florian Bieker
RSS Feed abonnieren
