Einteilung und Funktionen der Grundrechte - klausurgerecht aufgearbeitet
25.12.2025 | von Dr. Robert König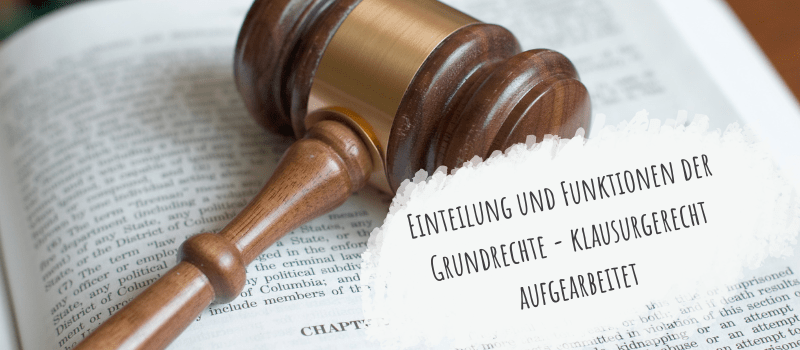
Verständnis ist elementar in der Grundrechte Klausur
Gerade in der Grundrechtsklausur ist ein tiefgreifendes Verständnis der grundrechtlichen Systematik und Dogmatik elementar, um eine gute Note zu schreiben. Hingegen ist es nicht wichtig, möglichst viele Urteile auswendig zu lernen. Wenn Du die Systematik der Grundrechte und der Grundrechtsprüfung einmal verinnerlicht hast, kannst Du problemlos jeden unbekannten Fall lösen.Daher widmen wir uns heute einem grundlegenden Kapitel, welches viele Jurastudierende gerne im Lehrbuch oder Skript überblättern: den Arten und Funktionen der Grundrechte.
I. Arten der Grundrechte
Nach Art. 1 III GG binden sämtliche Grundrechte Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland als unmittelbar geltendes Recht. Sämtliche staatliche Gewalt muss auf die Grundrechte achten. Die Bürgerinnen und Bürger können sich gegenüber dem Staat direkt auf die ihnen durch die Grundrechte gewährten Rechte berufen.Dogmatisch unterscheidet man zwischen Freiheitsgrundrechten (Abwehrrechten), Gleichheitsgrundrechten und Justizgrundrechten. Diese Einteilung ist wichtig, da sie mit einem jeweils unterschiedlichen Prüfungsaufbau in der Klausur korrespondiert.
1. Freiheitsrechte
Die Freiheitsgrundrechte (auch Abwehrrechte genannt) dienen dazu, unterschiedliche Lebensbereiche und Rechtsgüter des Einzelnen vor staatlichen Maßnahmen zu schützen und stehen im Mittelpunkt der durch das Grundgesetz gewährleisteten Grundrechte.Wenn man im Volksmund von Grundrechten redet, sind meistens die Freiheitsgrundrechte gemeint.
Beispiel: Die subsidiäre (d. h. gegenüber anderen Freiheitsrechten nachrangige) allgemeine Handlungsfreiheit gem. Art. 2 I GG; Religionsfreiheit aus Art. 4 GG; Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG; Berufsfreiheit aus Art. 12 I GG.
2. Gleichheitsrechte
Die Gleichheitsgrundrechte schützen vor einer unberechtigten Ungleichbehandlung durch öffentliche Gewalt.Es gibt zusätzlich zum allgemeinen Gleichheitssatz gemäß Art. 3 I GG des Grundgesetzes noch weitere, besondere und daher besonders zu prüfende Gleichheitssätze (z.B. Art. 3 II und Art. 3 III GG).
3. Justizgrundrechte
Die Rechtsweggarantie des Art. 19 IV GG soll als prozessuales Verfahrensrecht die materiell-rechtlichen Grundrechte absichern, indem sie dem Grundrechtsträger ermöglicht, die Wahrnehmung der Grundrechte auch gerichtlich durchzusetzen.Weitere Justizgrundrechte sind in den Art. 101 – 104 GG geregelt.
Die Justizgrundrechte sind essenziell, denn die Weimarer Republik hat gezeigt, dass ein Grundrechtsschutz, der nicht einklagbar ist, die Demokratie nicht vor ihren Feinden schützt.
II. Funktionen der Grundrechte
Die Einteilung der Grundrechte nach ihren Funktionen geht auf Georg Jellinek zurück, der zwischen 3 Funktionen unterscheidet (Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechten, 2. Aufl. 1905, S. 85 ff.):- Status negativus: Freiheit vom Staat – Grundrechte als Abwehrrechte
- Status positivus: Freiheit durch den Staat – Grundrechte als Leistungsrechte
- Status activus: Freiheit im und für den Staat – Grundrechte als (politische) Teilhaberechte
Die gängige aktuelle Dogmatik – der auch das Bundesverfassungsgericht grds. folgt – unterscheidet hingegen zwischen subjektiv-rechtlichen und objektiv-rechtlichen Grundrechtsfunktionen (Voßkuhle/Kaiser, JuS 2011, 411).
1. Subjektive Funktion: Abwehrrechte, Leistungsrechte, Mitwirkungsrechte und Gleichheitsrechte
Im herkömmlichen Sinne sind die Grundrechte zuallererst subjektive Rechte des Einzelnen.a) Abwehrrechte
Insbesondere stellen die Grundrechte als Freiheitsrechte Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat dar (Kingreen/Poscher, Rn. 135). Mithin darf der Einzelne für sich beanspruchen, dass der Staat einen Eingriff in seine Freiheitsrechte unterlässt.
b) Leistungsrechte
Manche Grundrechte sind darüber hinaus auch als Leistungsrechte ausgestaltet, die dem Einzelnen einen Anspruch gegen den Staat geben. In diesem Bereich ist der Bürger folglich auf das Handeln des Staates angewiesen, um das Grundrecht ausüben zu können.
Beispiel: Stellt der Staat Einrichtungen oder auch Leistungen den Bürgern zur Verfügung, so hat der Bürger einen subjektiven Anspruch auf Teilhabe. Z. B. stellt der Staat die Hochschulen zur Verfügung. In diesem Kontext hat jeder Bürger, der die jeweiligen Zulassungsvoraussetzungen für den betreffenden Studiengang erfüllt, ein Recht auf Zulassung zum Studiengang seiner Wahl (BVerfGE 33, 303, 332 – Numerus clausus I).
c) Mitwirkungsrechte
Die Mitwirkungsrechte gewährleisten das Recht des Bürgers, am staatsbürgerlichen Leben aktiv teilzunehmen.
Diese sog. Staatsbürgerrechte sind z.B. in Art. 12a II GG (Entscheidung zwischen Wehr- und Ersatzdienst), Art. 33 I bis III GG (Zugang zu öffentlichen Ämtern) und Art. 38 I 1, II GG (Wahlrecht) kodifiziert.
d) Gleichheitsrechte (Gleichbehandlungs- bzw. Nichtdiskriminierungsfunktion)
Die Gleichheitsrechte schützen vor einer unberechtigten Ungleichbehandlung durch öffentliche Gewalt. In spezifischen Situationen soll die staatliche Autorität sich nicht anders verhalten als in vergleichbaren Situationen zuvor. Wenn sie anders verhalten möchte, darf sie dies nur mit einem sachlichen Grund. Bei diesen Rechten liegt die Gleichbehandlungs- bzw. Nichtdiskriminierungsfunktion im Vordergrund.
2. Objektive Funktion: Einrichtungsgarantien, Schutzfunktion und mittelbare Drittwirkung
Die objektive Funktion der Grundrechte wurde durch die Rechtsprechung des BVerfG ausgestaltet. Hiernach verkörpern die Grundrechte eine objektive Wertordnung, welche als „verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts“ gilt (BVerfGE 7, 198, 205 – Lüth).a) Einrichtungsgarantien
Auch bestimmte Rechtseinrichtungen werden durch die Grundrechte garantiert. In diesem Sinne ist der Staat verpflichtet, die betreffenden Rechtseinrichtungen zu schaffen und zu wahren. Die Einrichtungsgarantien sind im Wesenskern nicht verfügbar für den Gesetzgeber. Deshalb ist es nicht erlaubt, die garantierten Rechtseinrichtungen an sich aufzuheben.
Terminologisch unterscheidet man in diesem Kontext zwischen zwei Arten der Garantien:
- Institutionsgarantien
- Institutionelle Garantieren
Beispiel: Privatautonomie und Vertragsfreiheit (Art. 2 I GG); Ehe und Familie (Art. 6 GG); Privatschulfreiheit (Art. 7 V GG); Privateigentum und Erbrecht (Art. 14 I GG).
Kraatz Tipp: Institutsgarantien können in der Klausur relevant werden, wenn staatliche Eingriffe in ein Abwehrrecht so gravierend sind, dass das Abwehrrecht praktisch aufgehoben wird.
Institutionelle Garantien sind verfassungsrechtliche Garantien bestimmter öffentlich-rechtlicher Rechtsinstitute, welche der (einfache) Gesetzgeber folglich nicht abschaffen darf.
Beispiel: Schulen (Art. 7 I GG); Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen (Art. 7 III 1 GG); Berufsbeamtentum (Art. 33 V GG).
b) Schutzfunktion
Die Grundrechte verpflichten im Grundsatz nur den Staat, nicht aber auch die Bürger. Daher ist es in bestimmten Grundrechtsbereichen notwendig, den Grundrechten auch eine Schutzfunktion zukommen zu lassen. Mithin ist der Staat dann verpflichtet, die Bürger in diesen Grundrechtsbereichen vor Eingriffen durch Dritte zu schützen.
Manche Grundrechte haben explizit normierte Schutzpflichten. Dies ist bei der Menschenwürde der Fall. Nach Art. 1 I 2 GG hat der Staat die Menschenwürde zu schützen.
c) Mittelbare Drittwirkung der Grundrechte
Unter Drittwirkung der Grundrechte diskutiert man die Frage, ob und inwieweit die Grundrechte auch im Privatrecht gelten. Die Grundrechte binden grds. nur den Staat, nicht hingegen Private. Private sind grundrechtsberechtigt, d.h. sie können sich auf die Grundrechte zu ihren Gunsten berufen, nicht jedoch grundrechtsverpflichtet.
Es ist heutzutage jedoch anerkannt, dass die Grundrechte als objektive Wertentscheidung und objektive Rechtsordnung auch in privatrechtliche Rechtsbeziehungen hineinstrahlen. Daher sind die Grundrechte insbesondere bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe und Generalklauseln im Zivilrecht zu berücksichtigen. Diese Problematik wird unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte behandelt. Hierzu haben wir bereits einen ausführlichen Blogartikel verfasst, den ich an dieser Stelle verlinke .
3. Verfahrensgarantie (status activus processualis)
Die verfahrensrechtliche Bedeutung der Grundrechte besteht darin, dass sie durch verfahrensrechtliche Maßnahmen bereits während des Entscheidungsprozesses geschützt sind. Es ist erforderlich, dass staatliche Verfahren so konzipiert werden, dass eine Beeinträchtigung materieller Grundrechtspositionen vermieden wird.Beispiel: Beispielsweise fordert Artikel 2 II 1 GG nicht nur Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit, sondern auch eine angemessene Gestaltung des Verfahrens im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren.
In diesem Sinne stehen manche Grundrechte ausdrücklich unter einem Verfahrensvorbehalt (z.B. Art. 2 II 2 i.V.m. Art. 104 II 4 GG).
Aber selbst Grundrechte, die nicht explizit einem Verfahrensvorbehalt unterliegen, fordern vom Staat, die Gerichts- und Verwaltungsverfahren so zu gestalten und zu organisieren, dass es dem Einzelnen ermöglicht wird, sich aktiv an dem Verfahren zu beteiligen, um seine Grundrechte effektiv umsetzen zu können.
Fazit zur Unterscheidung der Grundrechte
Um auch mit unbekannten verfassungsrechtlichen Fragestellungen im Jurastudium und Examen zurechtzukommen, ist es unerlässlich, die grundrechtliche Systematik zu kennen. Hierzu gehören auch die soeben dargestellten Gesichtspunkte „Einteilung und Funktionen der Grundrechte“.Wenn Du Dich im öffentlichen Recht verbessern möchtest, stehen Dir unsere erfahrenen Dozenten der Kraatz Group zur Seite. Du befindest Dich im Grundstudium, Hauptstudium oder schon in der Examensvorbereitung auf das 1. Staatsexamen? Dann ist die Akademie Kraatz Dein erster Ansprechpartner. Für ein erfolgreiches 2. Staatsexamen wendest Du Dich an die Assessor Akademie.
Melde Dich gerne bei uns für Deine Probestunde oder einen kostenlosen Beratungstermin.
Dr. Robert König
RSS Feed abonnieren
